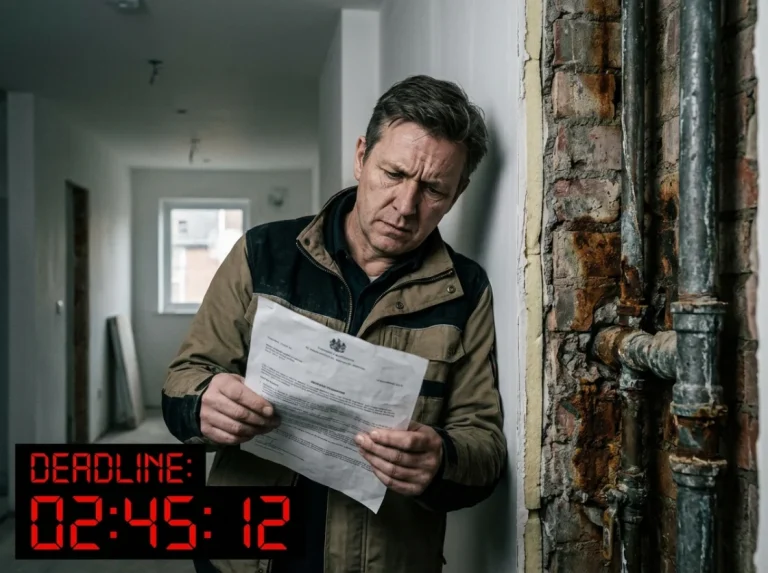Das Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG) hat seit seiner Einführung im Jahr 2015 den deutschen Wohnungsmarkt grundlegend verändert. Mit seinen Kernkomponenten – der Mietpreisbremse und dem Bestellerprinzip bei der Maklercourtage – wurde es als Antwort auf die stark steigenden Mieten in deutschen Großstädten konzipiert. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Analyse des MietNovG, seiner Entwicklung, regionalen Umsetzung und praktischen Auswirkungen für Mieter, Vermieter und die Immobilienwirtschaft.
Entstehung und Hintergrund des Mietrechtsnovellierungsgesetzes
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG) trat am 1. Juni 2015 in Kraft und stellte eine signifikante Reform des deutschen Mietrechts dar. Die Einführung erfolgte als Reaktion auf die zunehmende Wohnraumknappheit und die damit verbundenen rasant steigenden Mietpreise in Ballungsgebieten. Vor allem in Großstädten wie München, Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main hatte sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt für viele Mieter dramatisch verschärft, mit Mietsteigerungen von teilweise über 30 Prozent innerhalb weniger Jahre bei Neuvermietungen.
Die damalige Große Koalition aus CDU/CSU und SPD verfolgte mit dem Gesetz das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und übermäßigen Mietpreissteigerungen entgegenzuwirken, ohne dabei den Wohnungsneubau zu behindern. Das MietNovG wurde unter der Federführung des damaligen Bundesjustizministers Heiko Maas entwickelt und stellte einen Kompromiss dar, der sowohl Mieterinteressen berücksichtigen als auch Anreize für Investitionen in den Wohnungsbau erhalten sollte. Der Gesetzgebungsprozess war von intensiven Debatten begleitet, da Mieterverbände deutlich schärfere Regelungen forderten, während Vermieterverbände vor negativen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt warnten.
Immobilienkrise 2024 – Warum sozialer Wohnungsbau Priorität haben sollte
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Die Einführung des Mietrechtsnovellierungsgesetzes fiel in eine Zeit tiefgreifender Veränderungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Der Trend zur Urbanisierung hatte zu einem massiven Zuzug in die Ballungszentren geführt, während gleichzeitig die Bautätigkeit mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten konnte. Hinzu kamen die Niedrigzinsphase und die damit verbundene Suche nach Anlagemöglichkeiten, die Immobilien als Investitionsobjekte besonders attraktiv machten. Diese Faktoren führten zu einem deutlichen Anstieg der Immobilienpreise, der sich auch in den Mietpreisen widerspiegelte. Besonders betroffen waren einkommensschwächere Haushalte, für die bezahlbarer Wohnraum in den Innenstädten zunehmend unerreichbar wurde.
Gleichzeitig hatte sich die Struktur des Wohnungsmarktes verändert. Der Bestand an Sozialwohnungen war durch auslaufende Sozialbindungen kontinuierlich gesunken, während der private Mietwohnungsmarkt an Bedeutung gewonnen hatte. Diese Entwicklung verstärkte den Druck auf dem freien Wohnungsmarkt zusätzlich. In diesem Kontext sollte das MietNovG als regulierendes Instrument wirken, um die soziale Durchmischung in den Städten zu erhalten und einer fortschreitenden Gentrifizierung entgegenzuwirken. Die Gesetzesnovelle war damit Teil einer breiteren wohnungspolitischen Strategie, die auch den sozialen Wohnungsbau und städtebauliche Maßnahmen umfasste.
Die zwei Säulen des MietNovG: Mietpreisbremse und Bestellerprinzip
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz basiert auf zwei zentralen Säulen, die unterschiedliche Aspekte des Wohnungsmarktes regulieren: die Mietpreisbremse und das Bestellerprinzip bei der Wohnungsvermittlung. Diese beiden Komponenten zielen darauf ab, sowohl die Mietpreisentwicklung zu dämpfen als auch die Kosten bei der Wohnungssuche fairer zu verteilen. Während die Mietpreisbremse direkt auf die Höhe der Mieten bei Neuvermietungen Einfluss nimmt, regelt das Bestellerprinzip die Verteilung der Maklerkosten nach dem Verursacherprinzip.
Bei der Umsetzung des MietNovG wurde bewusst ein föderaler Ansatz gewählt, der den Bundesländern Spielraum bei der Anwendung der Mietpreisbremse lässt. Diese können durch Rechtsverordnungen festlegen, in welchen Gebieten ein „angespannter Wohnungsmarkt“ vorliegt und damit die Voraussetzungen für die Anwendung der Mietpreisbremse geschaffen sind. Das Bestellerprinzip hingegen gilt bundesweit einheitlich. Durch diesen zweisäuligen Ansatz sollten verschiedene Problemfelder des Wohnungsmarktes gleichzeitig adressiert werden, wobei regional unterschiedliche Wohnungsmarktbedingungen berücksichtigt werden können.
Die Mietpreisbremse im Detail
Die Mietpreisbremse stellt das Herzstück des Mietrechtsnovellierungsgesetzes dar und ist in den §§ 556d bis 556g des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert. Sie begrenzt die zulässige Miethöhe bei Neuvermietungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt auf maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Festlegung, welche Gebiete als „angespannt“ gelten, obliegt den Landesregierungen, die per Rechtsverordnung entsprechende Gebiete für maximal fünf Jahre bestimmen können. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird in der Regel durch lokale Mietspiegel ermittelt und bildet den durchschnittlichen Mietpreis für vergleichbare Wohnungen in der jeweiligen Lage ab.
Allerdings enthält die Mietpreisbremse eine Reihe von Ausnahmen, die ihre Wirksamkeit teilweise einschränken. So gilt sie nicht für Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, sowie für die erste Vermietung nach einer umfassenden Modernisierung. Zudem greift die Mietpreisbremse nicht, wenn bereits der Vormieter eine Miete gezahlt hat, die über der nach der Mietpreisbremse zulässigen Miete liegt – der Vermieter darf in diesem Fall die bisherige Miethöhe beibehalten. Diese Ausnahmen wurden bewusst eingefügt, um Investitionen in den Wohnungsneubau und die Modernisierung des Wohnungsbestandes nicht zu gefährden. Im Laufe der Zeit wurde die Mietpreisbremse mehrfach nachgeschärft, insbesondere durch erweiterte Auskunftspflichten der Vermieter und verbesserte Rügemöglichkeiten für Mieter im Mietvertrag.
Das Bestellerprinzip bei der Maklerprovision
Die zweite Säule des Mietrechtsnovellierungsgesetzes ist das sogenannte Bestellerprinzip, das in § 2 Abs. 1a des Wohnungsvermittlungsgesetzes (WoVermG) verankert wurde. Es regelt die Verteilung der Maklerkosten bei der Wohnungsvermittlung und folgt dem Grundsatz „Wer bestellt, der bezahlt“. In der Praxis bedeutet dies, dass derjenige die Maklercourtage tragen muss, der den Makler beauftragt hat. Da bei Mietwohnungen typischerweise der Vermieter den Makler mit der Wohnungsvermittlung beauftragt, führte diese Regelung dazu, dass die Maklerkosten in den meisten Fällen nicht mehr vom Mieter, sondern vom Vermieter zu tragen sind.
Vor Einführung des Bestellerprinzips war es üblich, dass Wohnungssuchende die Maklercourtage zahlen mussten, auch wenn sie den Makler nicht selbst beauftragt hatten. Dies führte zu erheblichen finanziellen Belastungen für Mieter, die neben Kaution und erster Miete zusätzlich eine Maklercourtage von meist zwei Nettokaltmieten plus Mehrwertsteuer aufbringen mussten. Das Bestellerprinzip hat diese Praxis grundlegend geändert und zu einer deutlichen Entlastung von Wohnungssuchenden geführt. Gleichzeitig hat es aber auch die Geschäftsmodelle vieler Immobilienmakler verändert, da Vermieter oftmals weniger bereit sind, Maklerprovisionen zu zahlen, oder niedrigere Sätze aushandeln. Eine Ausnahme vom Bestellerprinzip besteht, wenn der Makler ausschließlich aufgrund eines Suchauftrags des Wohnungssuchenden tätig wird – dann darf er auch vom Mieter eine Provision verlangen.
Änderungen und Nachbesserungen des MietNovG seit 2015
Seit seiner Einführung im Jahr 2015 wurde das Mietrechtsnovellierungsgesetz mehrfach überarbeitet und verschärft. Diese Anpassungen erfolgten hauptsächlich als Reaktion auf festgestellte Schwachstellen und Umgehungsmöglichkeiten in der ursprünglichen Fassung. Die erste bedeutende Nachbesserung erfolgte mit dem Mietrechtsanpassungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft trat. Es führte eine Auskunftspflicht für Vermieter ein, nach der diese unaufgefordert über Ausnahmen von der Mietpreisbremse informieren müssen, wenn sie eine höhere Miete als nach der Mietpreisbremse zulässig verlangen.
Eine weitere wesentliche Verschärfung kam mit dem Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn, das am 1. April 2020 in Kraft trat. Dieses erweiterte den Rückforderungsanspruch der Mieter bei zu hohen Mieten: Während zuvor überhöhte Mietzahlungen erst ab dem Zeitpunkt der Rüge zurückgefordert werden konnten, ist dies nun rückwirkend für bis zu 30 Monate möglich. Zugleich wurde die Mietpreisbremse, die ursprünglich bis 2020 befristet war, bis Ende 2025 verlängert. Diese Nachbesserungen zielten darauf ab, die Wirksamkeit des Gesetzes zu erhöhen und Mieterrechte zu stärken.
Das Mietrechtsanpassungsgesetz von 2019
Das Mietrechtsanpassungsgesetz stellte die erste umfassende Nachbesserung des MietNovG dar und führte mehrere wichtige Neuerungen ein. Zentral war die Einführung einer vorvertraglichen Auskunftspflicht für Vermieter nach § 556g Abs. 1a BGB. Demnach müssen Vermieter, die sich auf eine Ausnahme von der Mietpreisbremse berufen, den Mieter vor Vertragsabschluss unaufgefordert und in Textform über den Ausnahmegrund informieren. Kommt der Vermieter dieser Pflicht nicht nach, kann er sich für die Dauer von zwei Jahren nach Nachholung der Information nicht auf die Ausnahme berufen und muss sich an die Mietpreisbremse halten. Diese Regelung sollte die Transparenz erhöhen und Umgehungsstrategien eindämmen.
Darüber hinaus wurden mit dem Mietrechtsanpassungsgesetz die Möglichkeiten zur Umlage von Modernisierungskosten eingeschränkt. Die Mieterhöhung nach Modernisierung wurde bundesweit auf maximal 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren begrenzt, in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt sogar auf 2 Euro. Zudem wurde ein vereinfachtes Mieterhöhungsverfahren nach Modernisierung für kleinere Maßnahmen eingeführt und die Ankündigungspflicht für Modernisierungsmaßnahmen verschärft. Auch die Sanktionen gegen das sogenannte „Herausmodernisieren“ wurden verstärkt, indem es als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern bis zu 100.000 Euro belegt wurde. Diese Änderungen sollten sicherstellen, dass Modernisierungen nicht als Mittel zur Umgehung der Mietpreisbremse missbraucht werden können.
Die Verlängerung und Verschärfung des MietNovG im Jahr 2020
Mit dem „Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn“ wurde das MietNovG im Jahr 2020 erneut nachgebessert und bis Ende 2025 verlängert. Die bedeutendste Änderung betraf den Rückforderungsanspruch bei überhöhten Mieten. Während Mieter zuvor zu viel gezahlte Miete erst ab dem Zeitpunkt der Rüge zurückverlangen konnten, haben sie nun einen Anspruch auf Rückzahlung für die gesamte Mietzeit – allerdings begrenzt auf 30 Monate und nur, wenn die Rüge innerhalb dieser Zeit erfolgt. Diese Regelung stärkt die Position der Mieter erheblich und erhöht den Anreiz für Vermieter, sich an die Mietpreisbremse zu halten.
Die Verlängerung der Mietpreisbremse bis Ende 2025 gab den Bundesländern mehr Zeit, die angespannten Wohnungsmärkte zu entlasten und den Wohnungsbau voranzutreiben. Sie erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass sich die Lage auf den Wohnungsmärkten in vielen Ballungsräumen trotz der Mietpreisbremse nicht entspannt hatte. Die Bundesregierung begründete die Verlängerung mit der Notwendigkeit, den Mietern weiterhin Schutz vor überhöhten Mieten zu bieten, bis durch verstärkten Wohnungsneubau eine Entspannung der Märkte erreicht werden könne. Die Evaluierung der bisherigen Wirkung der Mietpreisbremse hatte gezeigt, dass diese zwar einen dämpfenden Effekt auf die Mietpreisentwicklung hatte, aber allein nicht ausreichte, um das Problem der Wohnungsknappheit zu lösen.
Regionale Umsetzung und Unterschiede des MietNovG
Die Umsetzung des Mietrechtsnovellierungsgesetzes erfolgt in Deutschland nicht einheitlich, sondern obliegt den einzelnen Bundesländern. Diese entscheiden durch Rechtsverordnungen, in welchen Gebieten ein „angespannter Wohnungsmarkt“ vorliegt und somit die Mietpreisbremse angewendet wird. Diese föderale Struktur führt zu erheblichen regionalen Unterschieden in der Anwendung. Während einige Bundesländer wie Berlin, Bayern oder Baden-Württemberg die Mietpreisbremse in zahlreichen Städten und Gemeinden eingeführt haben, verzichten andere Länder wie das Saarland oder Sachsen-Anhalt vollständig darauf.
Die Kriterien für die Festlegung eines angespannten Wohnungsmarktes sind im § 556d Abs. 2 BGB definiert. Demnach liegt ein solcher vor, wenn die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt, die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich übersteigt, die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit ausreichend Wohnraum geschaffen wird, oder ein geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht. Auf Basis dieser Kriterien haben die Bundesländer unterschiedliche Verordnungen erlassen, die teilweise mehrfach angepasst und aktualisiert wurden. Derzeit gilt die Mietpreisbremse in insgesamt 492 deutschen Städten und Gemeinden, in denen etwa 30 Prozent der Gesamtbevölkerung leben.
Fallbeispiele aus verschiedenen Bundesländern
Berlin hat als erstes Bundesland die Mietpreisbremse für das gesamte Stadtgebiet eingeführt und mehrfach verlängert, zuletzt bis zum 31. Mai 2025. Die Hauptstadt gilt als einer der am stärksten angespannten Wohnungsmärkte Deutschlands mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 7,21 Euro pro Quadratmeter (Stand 2024). Das Land Berlin hatte darüber hinaus versucht, mit dem „Mietendeckel“ eine noch strengere Regulierung einzuführen, die jedoch vom Bundesverfassungsgericht 2021 für verfassungswidrig erklärt wurde. In Bayern wurde die Mietpreisbremse zunächst für 138 Städte und Gemeinden eingeführt, nach einer zwischenzeitlichen Unwirksamkeitserklärung durch das Landgericht München jedoch neu erlassen und im Jahr 2022 auf 203 Städte ausgeweitet, was etwa 10 Prozent aller bayerischen Gemeinden entspricht.
In Hamburg gilt die Mietpreisbremse im gesamten Stadtgebiet, aktuell bis zum 30. Juni 2025. Die Hansestadt verzeichnet mit durchschnittlich 9,83 Euro pro Quadratmeter deutlich höhere Mietpreise als Berlin. Baden-Württemberg wendet die Mietpreisbremse in 89 Städten und Gemeinden an, was etwa 36 Prozent der Bevölkerung des Bundeslandes entspricht. Die Verordnung ist dort bis zum 30. Juni 2025 gültig. In Brandenburg wurde die Mietpreisbremse dagegen stark reduziert: Während sie zunächst in 31 Gemeinden galt, wurde sie bei der Verlängerung Ende 2020 auf nur noch 19 Gemeinden beschränkt. Diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Bundesländer den ihnen durch das MietNovG eingeräumten Gestaltungsspielraum nutzen und wie sich die Regulierungsintensität je nach regionaler Wohnungsmarktlage unterscheidet.
Praktische Auswirkungen des MietNovG auf den Wohnungsmarkt
Die Wirksamkeit des Mietrechtsnovellierungsgesetzes wird von Experten unterschiedlich bewertet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kam in einer Evaluation im Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass die Mietpreisbremse eine „messbare Bremswirkung“ entfaltet hat, die jedoch mit nur zwei bis vier Prozent moderat ausfällt. Interessanterweise stellten die Forscher fest, dass die Mieten in Gebieten mit Mietpreisbremse teilweise sogar stärker gestiegen sind als in Städten ohne entsprechende Regelung. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Mietpreisbremse allein nicht ausreicht, um den Preisdruck in angespannten Wohnungsmärkten effektiv zu reduzieren.
Das Bestellerprinzip hingegen hat zu einer deutlichen finanziellen Entlastung von Wohnungssuchenden geführt, da die Maklerkosten nun in den meisten Fällen vom Vermieter getragen werden. Dies hat jedoch auch Veränderungen im Maklermarkt bewirkt, da Vermieter seltener Makler beauftragen oder niedrigere Provisionen aushandeln. Einige Kritiker weisen darauf hin, dass Vermieter die Maklerkosten indirekt über höhere Mieten auf die Mieter umlegen könnten. Die Gesetzesänderung hat zudem zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Immobilienvermittlungsbereich geführt, wie beispielsweise Dienstleistungen, bei denen formal der Wohnungssuchende den Makler beauftragt und daher die Provision trägt.
Folgen für Mieter und Vermieter
Für Mieter hat das MietNovG durch die Begrenzung der Miethöhe bei Neuvermietungen und die Verlagerung der Maklerkosten auf den Vermieter zu einer finanziellen Entlastung geführt. Besonders in hochpreisigen Wohnungsmärkten können Mieter durch die Mietpreisbremse erhebliche Einsparungen erzielen. Die verschärften Auskunftspflichten der Vermieter und die erweiterten Rügemöglichkeiten haben zudem die Rechtssicherheit für Mieter erhöht. Allerdings berichten Mieterverbände, dass die Mietpreisbremse in der Praxis häufig nicht beachtet wird – der Mieterverein Hamburg schätzt beispielsweise, dass bei rund 40 Prozent der Neuvermietungen die Mietpreisbremse umgangen wird. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die Mietpreisbremse zu einer Verknappung des Angebots an Mietwohnungen führen kann, was die Wohnungssuche in angespannten Märkten erschwert.
Für Vermieter bedeutet das MietNovG eine Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit bei der Mietpreisgestaltung sowie zusätzliche Kosten durch die Übernahme der Maklercourtage. Dies kann die Rentabilität von Vermietungen insbesondere in hochpreisigen Märkten reduzieren. Vermieterverbände kritisieren, dass die Mietpreisbremse Investitionen in den Wohnungsbau hemmen könnte, da die Renditeerwartungen sinken. Die zahlreichen Ausnahmen und die daraus resultierenden Auskunftspflichten haben zudem zu einer höheren Komplexität und einem erhöhten Verwaltungsaufwand in der WEG-Verwaltung geführt. Nicht zuletzt besteht für Vermieter das Risiko, bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse Rückforderungen der Mieter in erheblicher Höhe zu erhalten, was die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zunehmend wichtiger macht.
Auswirkungen auf die Immobilienbranche
Die Einführung des Mietrechtsnovellierungsgesetzes hat auch die Immobilienbranche vor neue Herausforderungen gestellt. Besonders das Bestellerprinzip hat die Geschäftsmodelle vieler Immobilienmakler verändert. Da Vermieter weniger bereit sind, hohe Maklerprovisionen zu zahlen, haben viele Maklerunternehmen ihr Angebot diversifiziert und bieten nun verstärkt zusätzliche Dienstleistungen wie Immobilienbewertungen, Energieberatung oder umfassende Verwaltungsservices an. Andere haben sich stärker auf den Verkauf von Immobilien konzentriert, wo das Bestellerprinzip nicht gilt und höhere Provisionen erzielt werden können. Es kam auch zur Entwicklung neuer digitaler Plattformen, die Mietern und Vermietern eine direkte Vermittlung ohne klassischen Makler ermöglichen.
Die Mietpreisbremse hat zudem Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen im Immobilienbereich. Während Neubauprojekte von der Regulierung ausgenommen sind und daher weiterhin attraktiv bleiben, kann die Mietpreisbremse die Rentabilität von Investitionen in Bestandsimmobilien in regulierten Gebieten verringern. Dies könnte zu einer Verschiebung der Investitionsströme führen – weg von regulierten Innenstadtlagen hin zu nicht regulierten Randgebieten oder Neubauprojekten. Immobilienexperten berichten auch von einer zunehmenden Tendenz zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit Mietpreisbremse, was das Angebot an Mietwohnungen weiter verknappen könnte. Nicht zuletzt hat das MietNovG zu einem erhöhten Beratungsbedarf geführt, was Rechtsanwälten und spezialisierten Beratern im Immobilienbereich neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet hat.
Kritik und Diskussion zum Mietrechtsnovellierungsgesetz
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz wird seit seiner Einführung kontrovers diskutiert. Befürworter sehen in ihm ein notwendiges Instrument zum Schutz der Mieter vor überhöhten Mietpreisen und zur Erhaltung bezahlbaren Wohnraums in Ballungsgebieten. Sie argumentieren, dass die soziale Durchmischung in den Städten nur durch regulierende Eingriffe in den Wohnungsmarkt gewährleistet werden kann und die Mietpreisbremse einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Zudem habe das Bestellerprinzip zu mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Maklerkosten geführt und Wohnungssuchende finanziell entlastet.
Kritiker hingegen bezweifeln die Wirksamkeit der Mietpreisbremse und sehen in ihr sogar ein Hindernis für die Lösung der Wohnungsknappheit. Sie argumentieren, dass regulierende Eingriffe in den Markt langfristig zu einer Verknappung des Angebots führen, da die Investitionsbereitschaft sinkt. Die zahlreichen Ausnahmen und Umgehungsmöglichkeiten würden zudem die Effektivität der Mietpreisbremse untergraben. Statt mehr Regulierung fordern sie eine Förderung des Wohnungsneubaus, den Abbau bürokratischer Hürden und die Ausweisung neuer Bauflächen als nachhaltigere Lösung für die Wohnungsmarktprobleme.
Studienergebnisse zur Wirksamkeit
Die Wirksamkeit des Mietrechtsnovellierungsgesetzes wurde in mehreren wissenschaftlichen Studien untersucht, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellte in einer Untersuchung aus dem Jahr 2020 fest, dass die Mietpreisbremse einen moderaten preisdämpfenden Effekt von zwei bis vier Prozent hatte. Dies sei zwar messbar, bleibe aber hinter den Erwartungen zurück. Die Forscher stellten zudem fest, dass die Mietpreisbremse vorwiegend in mittleren Wohnlagen Wirkung zeigte, während in einfachen und sehr guten Lagen kaum Effekte nachweisbar waren. Andere Studien, etwa des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, kommen zu dem Schluss, dass die Mietpreisbremse kein geeignetes Instrument sei, um die Wohnraumknappheit zu bekämpfen, da sie Symptome und nicht Ursachen behandle.
Zum Bestellerprinzip gibt es weniger umfassende Studien, aber die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass es zu einer deutlichen Entlastung von Wohnungssuchenden geführt hat. Laut einer Umfrage des Deutschen Mieterbundes sparen Mieter durchschnittlich 2,5 Monatsmieten an Maklerkosten ein. Gleichzeitig hat die Regelung zu Veränderungen im Maklermarkt geführt, mit einer Konsolidierung und Professionalisierung der Branche. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt, dass die Anzahl der Maklerunternehmen seit Einführung des Bestellerprinzips um etwa 25 Prozent zurückgegangen ist, wobei vor allem kleinere Unternehmen vom Markt verschwunden sind. Die Studien zeigen insgesamt, dass das MietNovG zwar gewisse positive Effekte für Mieter hatte, als alleinige Maßnahme zur Lösung der Wohnraumproblematik jedoch nicht ausreicht.
Kernpunkte des Mietrechtsnovellierungsgesetzes (MietNovG) im Überblick:
- Einführung der Mietpreisbremse: Begrenzung der Miethöhe bei Neuvermietungen auf maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt
- Bestellerprinzip bei der Maklerprovision: Wer den Makler beauftragt, muss die Provision zahlen – in der Regel der Vermieter
- Ausnahmen von der Mietpreisbremse: Neubauten nach dem 1. Oktober 2014, umfassend modernisierte Wohnungen, Beibehaltung einer bereits über der Mietpreisbremse liegenden Vormiete
- Regionale Umsetzung: Die Bundesländer bestimmen durch Rechtsverordnungen, wo ein „angespannter Wohnungsmarkt“ vorliegt
- Verlängerung und Verschärfung: 2020 wurde die Mietpreisbremse bis Ende 2025 verlängert und um einen rückwirkenden Rückforderungsanspruch ergänzt
- Auskunftspflicht: Vermieter müssen unaufgefordert über Ausnahmen von der Mietpreisbremse informieren
- Moderate Wirkung: Studien zeigen einen preisdämpfenden Effekt von 2-4%, aber keine Lösung der grundlegenden Wohnraumknappheit
Zukunftsperspektiven des Mietrechtsnovellierungsgesetzes
Die Zukunft des Mietrechtsnovellierungsgesetzes steht aktuell an einem Wendepunkt. Die derzeitige Regelung der Mietpreisbremse ist bis Ende 2025 befristet, danach müsste sie erneut verlängert werden. Die politische Diskussion über eine mögliche Verlängerung und Weiterentwicklung hat bereits begonnen. Die neue Bundesregierung aus Union und SPD hat in Sondierungsgesprächen signalisiert, die Mietpreisbremse zunächst für zwei weitere Jahre verlängern zu wollen. Der Bundesrat hat darüber hinaus einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine Verlängerung bis 2029 und eine Ausweitung auf Neubauten, die zwischen 2014 und 2019 erstmals vermietet wurden, vorsieht.
Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung einer möglichen Verlängerung ist klar, dass das MietNovG Teil eines umfassenderen wohnungspolitischen Ansatzes sein muss. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass regulierende Eingriffe in den Mietmarkt allein nicht ausreichen, um die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen zu beheben. Vielmehr bedarf es einer Kombination aus Marktregulierung, Förderung des Wohnungsneubaus, Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und stadtplanerischen Maßnahmen. Die künftige Entwicklung des MietNovG wird daher maßgeblich davon abhängen, wie es in eine solche ganzheitliche Strategie eingebettet wird und inwieweit es gelingt, seine Wirksamkeit zu verbessern und gleichzeitig Investitionsanreize zu erhalten.
Mögliche Reformansätze und Alternativen
Für eine Weiterentwicklung des Mietrechtsnovellierungsgesetzes werden verschiedene Reformansätze diskutiert. Eine Option wäre die Verschärfung der Mietpreisbremse durch die Reduzierung der Ausnahmen, beispielsweise indem die Neubauregelung auf einen kürzeren Zeitraum beschränkt oder die Vormieterregelung eingeschränkt wird. Auch eine Verlängerung des Rückforderungszeitraums bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse von derzeit 30 Monaten könnte die Position der Mieter stärken. Zur besseren Durchsetzung der Mietpreisbremse wird zudem die Einführung eines Verbandsklagerechts für Mietervereine diskutiert, um systematische Verstöße effizienter ahnden zu können.
Neben einer Reform des bestehenden MietNovG werden auch alternative oder ergänzende Ansätze zur Mietregulierung erwogen. Dazu gehören verstärkte steuerliche Anreize für den Wohnungsneubau, wie sie Baden-Württembergs Bauministerin Nicole Razavi als Alternative zur Mietpreisbremse vorschlägt, oder die Förderung von Baugenossenschaften und gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. Eine weitere diskutierte Option ist die Bodenwertsteuer, die unbebaute Grundstücke in Ballungsräumen höher besteuern und so Anreize für deren Bebauung schaffen würde. Auch innovative Konzepte wie kommunale Vorkaufsrechte, Konzeptvergaben bei der Grundstücksveräußerung oder die Förderung alternativer Wohnformen könnten zur Entspannung der Wohnungsmärkte beitragen. Diese Ansätze zeigen, dass die Zukunft der Wohnungspolitik über eine bloße Verlängerung des MietNovG hinausgeht und innovative, ganzheitliche Lösungen erfordert.
Zahlen & Daten zur Mietpreisbremse:
1. Chronologie des Mietrechtsnovellierungsgesetzes (MietNovG)
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 27.03.2015 | Verabschiedung des MietNovG | Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Mietrechtsnovellierungsgesetz unter Federführung von Bundesjustizminister Heiko Maas. |
| 01.06.2015 | Inkrafttreten des MietNovG | Das Gesetz tritt mit seinen beiden Hauptsäulen in Kraft: der Mietpreisbremse (§§ 556d-556g BGB) und dem Bestellerprinzip bei der Wohnungsvermittlung (§ 2 Abs. 1a WoVermG). |
| 01.06.2015 | Erste Mietpreisbremsen-Verordnungen | Berlin führt als erstes Bundesland die Mietpreisbremse für das gesamte Stadtgebiet ein. Weitere Bundesländer folgen. |
| 2016-2018 | Erste gerichtliche Entscheidungen | Verschiedene Landgerichte erklären die Mietpreisbremsen-Verordnungen einzelner Bundesländer wegen formaler Mängel für unwirksam (u.a. in Bayern, Hamburg und Hessen). |
| 18.07.2019 | Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts | Das BVerfG erklärt die Mietpreisbremse für verfassungskonform (Az. 1 BvL 1/18, 1 BvL 4/18, 1 BvR 1595/18) und weist Beschwerden von Vermietern zurück. |
| 01.01.2019 | Mietrechtsanpassungsgesetz | Einführung der Auskunftspflicht für Vermieter über Ausnahmen von der Mietpreisbremse; Begrenzung der Modernisierungsumlage auf 3 Euro pro m² (2 Euro in angespannten Wohnungsmärkten); Sanktionen gegen „Herausmodernisieren“. |
| 01.04.2020 | Verlängerung und Verschärfung | Verlängerung der Mietpreisbremse bis 31.12.2025; Einführung des rückwirkenden Rückforderungsanspruchs für zu viel gezahlte Miete (bis zu 30 Monate). |
| Februar 2025 | Bundesrats-Initiative | Der Bundesrat bringt einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 ein, der auch Neubauten zwischen 2014 und 2019 einbeziehen soll. |
| 31.12.2025 | Geplantes Auslaufen | Nach aktueller Rechtslage läuft die Mietpreisbremse Ende 2025 aus, falls sie nicht verlängert wird. Die neue Regierung aus Union und SPD hat eine Verlängerung um 2 Jahre signalisiert. |
2. Kernpunkte des Mietrechtsnovellierungsgesetzes
| Komponente | Regelung |
|---|---|
| Mietpreisbremse (§§ 556d-556g BGB) |
|
| Ausnahmen von der Mietpreisbremse |
|
| Bestellerprinzip (§ 2 Abs. 1a WoVermG) |
|
| Verschärfungen seit 2019 |
|
3. Regionale Umsetzung der Mietpreisbremse (Stand: Mai 2025)
| Bundesland | Mietpreisbremse | Anzahl der betroffenen Gemeinden | Gültig bis | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Ja | Gesamtes Stadtgebiet | 31.05.2025 | Erster „Mietendeckel“ 2020-2021 (vom BVerfG für verfassungswidrig erklärt) |
| Bayern | Ja | 203 | 31.12.2025 | Erste Verordnung 2017 für unwirksam erklärt, 2019 neu erlassen und 2022 ausgeweitet |
| Baden-Württemberg | Ja | 89 | 30.06.2025 | Umfasst ca. 36% der Bevölkerung des Bundeslandes |
| Hamburg | Ja | Gesamtes Stadtgebiet | 30.06.2025 | Hohe Durchschnittsmiete von 9,83 €/m² |
| Nordrhein-Westfalen | Ja | 57 | 30.06.2025 | Ursprünglich 18 Gemeinden, seit 2024 erweitert |
| Hessen | Ja | 49 | 26.11.2025 | Erste Verordnung für unwirksam erklärt, 2019 neu erlassen |
| Brandenburg | Ja | 19 | 31.12.2025 | Reduzierung von ursprünglich 31 auf 19 Gemeinden |
| Schleswig-Holstein | Nein | – | – | Mietpreisbremse 2019 wegen mangelnder Wirksamkeit abgeschafft |
| Sachsen | Nein | – | – | Keine Verordnung erlassen |
| Sachsen-Anhalt | Nein | – | – | Keine Verordnung erlassen |
| Saarland | Nein | – | – | Keine Verordnung erlassen |
4. Wirksamkeit des MietNovG laut wissenschaftlichen Studien
| Komponente | Bewertete Wirksamkeit |
|---|---|
| Mietpreisbremse |
|
| Bestellerprinzip |
|
Bilanz und Ausblick zum Mietrechtsnovellierungsgesetz
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz hat seit seiner Einführung im Jahr 2015 den deutschen Wohnungsmarkt in vielerlei Hinsicht geprägt. Mit seinen beiden Säulen – der Mietpreisbremse und dem Bestellerprinzip – hat es zu einer gewissen Dämpfung der Mietpreisentwicklung und einer finanziellen Entlastung von Wohnungssuchenden beigetragen. Die mehrfachen Nachbesserungen und Verschärfungen haben seine Wirksamkeit schrittweise erhöht, insbesondere durch die Einführung von Auskunftspflichten für Vermieter und erweiterten Rückforderungsmöglichkeiten für Mieter. Dennoch bleibt seine Gesamtwirkung hinter den Erwartungen zurück, und die grundlegenden Probleme des Wohnungsmarktes – allen voran die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in Ballungsgebieten – bestehen weiterhin.
Die Zukunft des MietNovG wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt, es in eine umfassendere wohnungspolitische Strategie einzubetten, die sowohl die Interessen der Mieter als auch die der Vermieter und Investoren berücksichtigt. Die anstehende Entscheidung über eine mögliche Verlängerung über 2025 hinaus bietet die Chance, das Gesetz weiterzuentwickeln und seine Wirksamkeit zu verbessern. Dabei sollten die Erfahrungen der letzten Jahre genutzt werden, um Schwachstellen zu beheben und gleichzeitig Anreize für Investitionen in den Wohnungsneubau zu schaffen. Nur eine ausgewogene Kombination aus marktregulierenden Maßnahmen und Förderung des Wohnungsbaus kann langfristig zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes führen und bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten sichern.