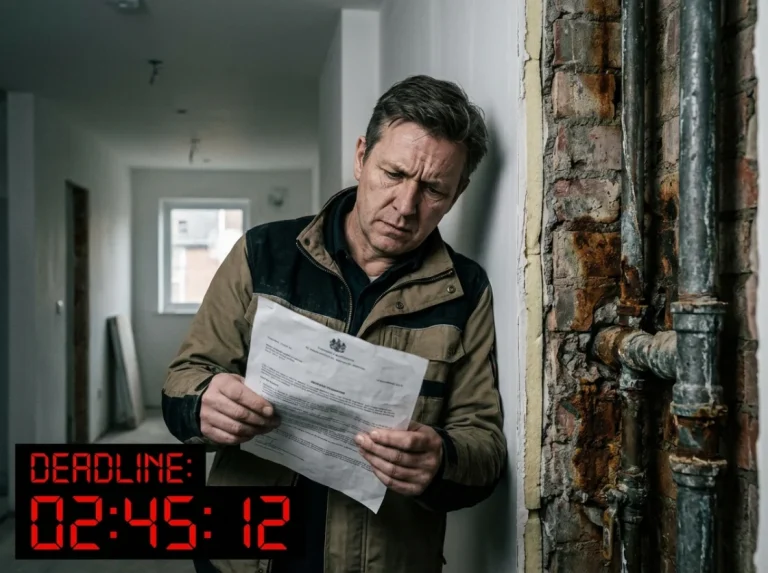Seit dem 17.10.2024 können Eigentümerversammlungen nun auch vollständig virtuell bzw. digital abgehalten werden. Was die neue gesetzliche Regelung mit sich bringt und wie eine digitale Versammlung gelingt, erfahren Sie hier.
Trotz allgemein schleppender Digitalisierung in vielen Bereichen hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen einen weiteren und wichtigen Schritt Richtung Digitalisierung vollzogen. Seit dem 17.10.2024 sind Eigentümerversammlungen nicht nur in Präsenz, sondern hybrid oder sogar vollständig virtuell möglich. Dennoch kann auf jegliche Präsenz (noch) nicht in Gänze verzichtet werden. Was Sie über die Neuerung wissen müssen, was es bei der digitalen Eigentümerversammlung zu beachten gilt und alles, was Sie sonst rund um das Thema digitale Wohnungseigentümerversammlung wissen müssen, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Digitale Eigentümerversammlung muss durch Beschluss ermöglicht werden
Jedem Wohnungseigentümer, der Teil einer Eigentümergemeinschaft ist, kann nur ans Herz gelegt werden, die Eigentümerversammlungen wahrzunehmen. Die Gemeinschaft lebt von der Beteiligung ihrer Mitglieder und für viele Vorhaben ist das Mitwirken der einzelnen Eigentümer – nicht zuletzt auch bei Beschlussfassungen – notwendig. Eine immense Erleichterung der Eigentümerversammlung soll eine Neuregelung des Wohnungseigentümergesetzes (WEG) bewirken. Im Rahmen einer Gesetzesnovelle hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen das WEG dahingehend maßgeblich verändert.
Der neue § 23 Abs. 1a WEG lautet seit dem 17.10.2024 wie folgt:
„Die Wohnungseigentümer können mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschließen, dass die Versammlung innerhalb eines Zeitraums von längstens drei Jahren ab Beschlussfassung ohne physische Präsenz der Wohnungseigentümer und des Verwalters an einem Versammlungsort stattfindet oder stattfinden kann (virtuelle Wohnungseigentümerversammlung). Die virtuelle Wohnungseigentümerversammlung muss hinsichtlich der Teilnahme und Rechteausübung mit einer Präsenzversammlung vergleichbar sein.“
Damit ermöglicht der Gesetzgeber, die Eigentümerversammlung auch digital abhalten zu können.
Mit der Ermöglichung der rein virtuellen Versammlung durch die WEG-Reform 2020 gibt es nun insgesamt drei Möglichkeiten der Versammlung. Die digitale Versammlung ergänzt die klassische Eigentümerversammlung in Präsenz und die hybride Versammlung, die die Online-Teilnahme an der Präsenzveranstaltung ermöglicht.
Um die Eigentümerversammlung komplett digital abhalten zu können, müssen die Wohnungseigentümer in der Versammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln wirksam beschließen, rein virtuelle Versammlungen zu ermöglichen. Ab dieser Beschlussfassung gilt dies für maximal drei Jahre.
Das hohe Quorum von 75 Prozent soll nach der Begründung des Gesetzgebers der besonderen Bedeutung der Eigentümerversammlung Rechnung tragen und ein „Wegschieben“ der Versammlung verhindern. Die Befristung auf drei Jahre soll zudem sicherstellen, dass Erwerber von Sondereigentum – also neue Wohnungskäufer – nicht uneingeschränkt an Beschlüsse gebunden sind, die vor ihrem Eintritt gefasst wurden. Darüber hinaus wird mit der Regelung Raum dafür geschaffen, dass die Eigentümergemeinschaft umdenkt.
Übergangsregelung sieht bis 2028 eine Eigentümerversammlung in Präsenz vor
So ganz ohne Präsenz geht es dann aber doch (noch) nicht – oder eben doch? Begleitet wird die neue Regelung im WEG nämlich durch eine verabschiedete Übergangsregelung. Demnach muss bis einschließlich 2028 mindestens eine Versammlung im Jahr weiterhin in Präsenz stattfinden, wenn die Eigentümergemeinschaft die Abhaltung digitaler Versammlungen vor dem 01.01.2028 beschließt.
Gleichzeitig können die Wohnungseigentümer allerdings auch auf die Abhaltung dieser einen Eigentümerversammlung in Präsenz wiederum durch einstimmigen Beschluss verzichten. Es liegt also in der Hand der Gemeinschaft selbst, ob auch auf die Bestimmung der Übergangsregelung verzichtet werden kann oder nicht.
Beschließen die Eigentümer also in diesem Jahr noch eine rein virtuelle Versammlung für die kommenden drei Jahre – also 2025, 2026 und 2027 – muss im Jahr 2028 wieder eine Präsenzveranstaltung oder eine hybride Versammlung stattfinden. Auf dieser Versammlung kann dann aber erneut die Durchführung der rein digitalen Versammlung für drei weitere Jahre mit entsprechender Mehrheit beschlossen werden. Dies ist aber erst in der Versammlung 2028 möglich. In einer der vorherigen virtuellen Versammlung – etwa im Jahr 2027 – kann ein solcher Beschluss nicht ergehen. Dies wäre eine unzulässige Umgehung der gesetzlichen Regelung und der entsprechende Beschluss wäre nichtig.
Grundlage der Übergangsregelung ist der neue § 48 Abs. 6 WEG:
„Fassen die Wohnungseigentümer vor dem 1. Januar 2028 einen Beschluss nach § 23 Absatz 1a, ist bis einschließlich 2028 mindestens einmal im Jahr eine Präsenzversammlung durchzuführen, sofern die Wohnungseigentümer hierauf nicht durch einstimmigen Beschluss verzichten. Ein Verstoß gegen diese Pflicht führt nicht zur Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit der in einer virtuellen Wohnungseigentümerversammlung gefassten Beschlüsse.“
Diese neue Regelung macht zudem deutlich, dass selbst ein Verstoß gegen den grundsätzlich notwendigen, einstimmigen Beschluss zum Verzicht der Präsenzversammlung nicht dazu führt, dass Beschlüsse, die auf einer digitalen Versammlung beschlossen wurden, nichtig oder anfechtbar wären.
Das ist bei der Durchführung der digitalen Eigentümerversammlung zu beachten
Findet sich eine Mehrheit von 75 Prozent der Eigentümergemeinschaft, um virtuelle Eigentümerversammlungen zu beschließen, sind einige wichtige Dinge bei der Durchführung zu beachten.
Wichtig: Virtuelle Eigentümerversammlung darf nicht zu unbilligen Benachteiligungen führen
Dies beginnt bereits mit dem Beschluss über die Durchführung digitaler Versammlungen selbst. Denn der entsprechende Beschluss muss selbstverständlich ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen. Dabei ist eine unbillige Benachteiligung einzelner Eigentümer unzulässig. Dies ist zum Beispiel dann denkbar, wenn einzelne Wohnungseigentümer nicht an digitalen Eigentümerversammlungen teilnehmen können und das bekannt ist.
Andersherum ist es ebenso denkbar, dass einzelne Eigentümer aufgrund körperlicher Hindernisse nicht in der Lage sind, physisch an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen. In diesem Fall könnte eine stets reine Präsenzveranstaltung ebenso unbillig sein, sofern diese nicht wenigstens online verfolgt werden kann (hybride Eigentümerversammlung). Was eine Benachteiligung darstellt und was nicht, lässt sich letztlich nicht ausnahmslos bestimmen, sondern ist eine Frage des Einzelfalls.
Anlässlich der Beschlussfassung für die Durchführung von virtuellen Eigentümerversammlungen ist deshalb im Zweifel auch zu erörtern, wie Eigentümer unterstützt werden können, die nicht imstande sind, an diesen teilzunehmen. Die Lösung kann dann etwa in einem Teilnehmerraum liegen, in dem digital an der Eigentümerversammlung teilgenommen werden kann. Ein solcher Teilnehmerraum kann etwa beim Verwalter eingerichtet werden. Dies stellt zudem auch sicher, dass Eigentümer bei technischen Problemen weiterhin die Möglichkeit haben, an der Versammlung teilzunehmen. Ebenfalls denkbar ist die Teilnahme einzelner Eigentümer bei jeweils anderen Eigentümern oder aber die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht, wenn ein einzelner Eigentümer an der Versammlung nicht teilnehmen kann. Die genauen Erörterungen und Herausforderungen sowie deren Lösungen sollten zweckmäßigerweise im Versammlungsprotokoll dokumentiert werden.
Der Beschluss sollte die Software bestimmen
Eine digitale Eigentümerversammlung lässt sich nicht ohne entsprechende Konferenzsoftware abhalten. Egal ob Zoom, Webex oder eine Software des Verwalters – im Beschluss sollte die zu verwendende Konferenzsoftware unbedingt ausdrücklich benannt werden. Denn die Rechtsprechung fordert die Angabe der Software bereits bei hybriden Versammlungen (so etwa AG Heidelberg, Urteil vom 30.03.2022, Aktenzeichen: 45 C 102/21). Dies muss erst Recht für komplett digitale Versammlungen gelten. Ist die Benennung der konkreten Software in dem Beschluss über die zukünftige Durchführung virtueller Versammlungen noch nicht enthalten, kann aber auch ein separater Beschluss über die Software in einer Eigentümerversammlung oder im schriftlichen Verfahren (Umlaufverfahren) ergehen.
Durchführung muss mit einer Präsenzversammlung vergleichbar sein
Einen zentralen Punkt für die korrekte Durchführung der virtuellen Eigentümerversammlung gibt § 23 Abs. 1a Satz 2 WEG vor. Demnach muss die digitale Versammlung hinsichtlich der Teilnahme und Rechtsausübung mit einer Präsenzversammlung vergleichbar sein. Konkret bedeutet dies, dass sämtliche Eigentümer der Gemeinschaft teilnehmen können und in der Lage sein müssen, von ihrem Frage-, Rede- und Stimmrecht Gebrauch zu machen. Nur dann sind die gesetzlichen Vorgaben gewahrt und die Eigentümerversammlung auch beschlussfähig.
Um dies zu gewährleisten, sollten im Beschluss über die Durchführung der virtuellen Versammlung sichere Anmeldewege aufgeführt werden und die Übertragungsart geregelt sein. Diese hat wiederum datenschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass ausschließlich Eigentümer der Gemeinschaft an der virtuellen Versammlung teilnehmen können (vgl. AG Heidelberg, Urteil vom 30.03.2022, Aktenzeichen: 45 C 102/21). Dies ist durch eine Zugangsbeschränkung – etwa durch ein Passwort oder Zugangscode realisierbar.
Des weiteren muss der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der Eigentümerversammlung gewahrt werden. Das bedeutet, dass nicht nur ausschließlich Eigentümer der Gemeinschaft an der Versammlung teilnehmen dürfen, sondern dass auch niemand sonst die Versammlung verfolgen darf. Als Übertragungsweg eignet sich eine Videokonferenz durch Zwei-Wege-Audio- und Videoverbindung in Echtzeit. Die teilnehmenden Personen sollten zudem vom Verwalter mittels Videofunktion überprüft werden. Eine Aufzeichnung der Versammlung ist hingegen nicht ohne Zustimmung der Teilnehmer möglich.
Technische Probleme können unter Umständen zur Beschlussanfechtung führen
Schließlich können auch technische Störungen die Suppe versalzen. Denn treten tatsächlich Störungen technischer Art, kann dies im Zweifel sogar zu Anfechtung von Beschlüssen führen. Dies kann der Fall sein, wenn einzelne Eigentümer die Beschlussfassung selbst nicht adäquat verfolgen konnten oder aber bereits die Erörterungen im Vorfeld nicht mitbekommen haben. Wurde dadurch das Rede-, Frage- oder Stimmrecht beschnitten, liegt eine Anfechtung des entsprechenden Beschlusses besonders nah. Anders liegt der Fall aber möglicherweise, wenn die technischen Probleme der Sphäre des Eigentümers selbst zuzuordnen sind. Dann könnte dieser einzelne Eigentümer nicht zur Anfechtung berechtigt sein.
Konkrete Regelungen über technische Störungen lassen sich im WEG auch nach der Reform allerdings nicht finden. Möglich ist indes ein Beschluss der Eigentümerversammlung, wonach technische Störungen in der Sphäre der Eigentümer nicht zu einer Pflicht zur Beendigung der virtuellen Eigentümerversammlung führt. Schließlich ist die Entscheidung, an der digitalen Versammlung teilzunehmen, Sache des jeweiligen Eigentümers (AG München, Urteil vom 27.04.2022, Aktenzeichen: 1292 C 19128/21 WEG). Darüber hinaus kann sich ein Eigentümer, den technische Probleme plagen, im schlimmsten Fall auch vertreten lassen.
Virtuelle Eigentümerversammlungen haben Vor- und Nachteile
Wenn Sie Wohnungseigentümer und damit Teil einer Eigentümergemeinschaft sind, sollten Sie sich der Vorteile aber auch der möglichen Nachteile der Durchführung einer rein digitalen Eigentümerversammlung im Klaren sein. So sehr die durch die WEG-Reform geschaffene Möglichkeit dieser neuen Art der Versammlung auch ist – letztlich ist es für jede Eigentümergemeinschaft einer individuelle Abwägung von positiven und potenziell negativen Aspekten, die eine digitale Versammlung mit sich bringt.
Mögliche Nachteile liegen nämlich wie bereits angerissen in der möglicherweise fehlenden Teilnahmemöglichkeit für technisch und digital unerfahrene Eigentümer. Wenn es sich nicht um eine unbillige Benachteiligung handelt und der Beschluss über die virtuelle Versammlung zulässig und wirksam ist, sind jene Eigentümer dann auf die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht oder auf die Teilnahme bei einem anderen Eigentümer oder – falls gegeben – in einem Teilnahmeraum angewiesen.
Zudem kostet die Einführung und Einrichtung der virtuellen Versammlung Geld, Aufwand und Zeit. Dies betrifft insbesondere die technische Ausstattung. Die nötige Konferenzsoftware kann Kosten verursachen, wie auch deren Installation und die Einarbeitung erheblich Zeit in Anspruch nehmen.
Auf der anderen Seite weist die virtuelle Durchführung der Versammlung auch immense Vorteile auf. Denn auch wenn die Software und ihre Installation Geld kosten mag, so werden andererseits Kosten und der Aufwand für die Anmietung von Räumlichkeiten gespart, die besonders bei größeren Eigentümergemeinschaften durchaus beachtlich sein können.
Hinzu kommt, dass die virtuelle Abhaltung für viele Eigentümer den Vorteil bietet, dass diese Anreise- und Übernachtungskosten und auch Zeit sparen. Dieser Vorteil wiegt natürlich vor allem bei Eigentümern schwer, die weit entfernt wohnen.
Schließlich erleichtert die digitale Durchführung der Eigentümerversammlung auch die Planung. Ist keine Präsenz notwendig, lässt sich erfahrungsgemäß auch leichter einen Termin finden und die Eigentümer können ortsunabhängig und bequem an der Versammlung teilnehmen.